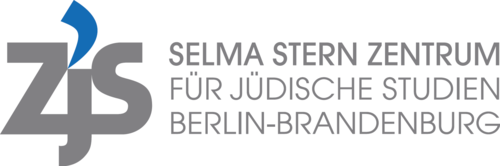Niklas Lämmel

Promotionsstudent am Institut für Philosophie der Universität Kassel
Niklas Lämmel studierte Politikwissenschaft, Interdisziplinäre Antisemitismusforschung und Holocaust Studies in Berlin, Prag und Victoria (Kanada). Von 2016 bis 2021 arbeitete er als studentische und wissenschaftliche Hilfskraft beim Editionsprojekt „Judenverfolgung 1933–1945“. Er promoviert am Institut für Philosophie der Universität Kassel mit einer Arbeit zum Verhältnis von Antisemitismustheorie und Erkenntniskritik bei Theodor W. Adorno. Von September bis Dezember 2024 verbrachte er einen Forschungsaufenthalt am Minda de Gunzburg Center for European Studies der Harvard University. Seit Oktober 2024 ist er erster Vorsitzender des Villigster Forschungsforums zu Nationalsozialismus, Rassismus und Antisemitismus. Zu seinen Forschungsinteressen zählen Kritische Theorie, Antisemitismusforschung, Erinnerungskultur und die politische Theorie mittel- und osteuropäischer Dissidenten.
Dissertationsprojekt: „Erkenntnis und Judenhass. Theodor W. Adornos philosophische Reflexion des Antisemitismus“
Theodor W. Adornos Reflexion des Antisemitismus und seine Auseinandersetzung mit erkenntnistheoretischen Fragen werden in der Regel getrennt voneinander behandelt. Während die sozialwissenschaftliche Antisemitismusforschung zweifelsohne wichtige Impulse von den Elementen des Antisemitismus und Adornos erinnerungspolitischen Interventionen erhalten hat, klammert sie dessen philosophisches Werk weitestgehend aus. In der philosophischen Rezeption zeigt sich eine spiegelbildliche Lücke: Hier ist es Adornos Beschäftigung mit dem Antisemitismus, die nur selten thematisiert wird.
In meinem Dissertationsprojekt möchte ich diese Trennung – die gesellschaftstheoretische Beschäftigung mit Antisemitismus hier, die erkenntniskritische Philosophie dort – aufbrechen. Ausgangspunkt ist die Beobachtung, dass Horkheimer und Adorno das Problem der Judenfeindschaft bereits in der Dialektik der Aufklärung maßgeblich aus einer erkenntniskritischen Perspektive betrachten. Dabei betonen sie, dass der Antisemitismus in enger Verwandtschaft zu der modernen „Gestalt des Geistes“ steht, dessen Wurzeln sich bis in die Frühgeschichte zurückverfolgen lassen. Adornos spätere Negative Dialektik kann wiederum als Fortsetzung dieser Reflexion verstanden werden: Indem er unterschiedliche erkenntnistheoretischen Kategorien einer „metakritischen“ Reflexion unterzieht, trägt er dazu bei, die geistige Struktur des Antisemitismus zu entschlüsseln.
Anhand dieser Überlegungen wird nicht nur exemplarisch deutlich, wie eine philosophische Kritik des Antisemitismus aussehen kann. Auch das weit verbreitete Bild des Pessimisten Adorno lässt sich korrigieren. Auf Grundlage seiner „metakritischen“ Überlegungen formuliert er eine „Utopie der Erkenntnis“: Sie beschreibt die Umrisse einer geistigen Praxis, die bereits in ihrer Grundstruktur gegen den Antisemitismus gerichtet ist.
Publikationsliste
- 2025, „Von den ‚Grenzen der Aufklärung‘ zur ‚Selbstbesinnung des Geistes‘“. Zum Verhältnis von Antisemitismustheorie und Erkenntniskritik bei Theodor W. Adorno, Zeitschrift für Kritische Theorie, Heft 60/61.
- 2023, „Antisemitismus zwischen absoluter Distanzierung und ambivalenter Objektnähe. Der Begriff der Mimesis in der Dialektik der Aufklärung“, Vennman, Stefan et. al.: Warum Antisemitismus? Zur Politik der Judenfeindschaft im Spannungsfeld von Kollektiv und Subjekt, Velbrück: Weilerswist.
- 2023, “Miklós Haraszti’s A Worker in a Worker’s State: A Dissident Contribution to the Neue Marx Lektüre?”, Journal for the History of Ideas Blog (online).
- 2022, “Review: Adorno and the Ban on images by Sebastian Truskolaski”, Political Theology, Volume 23, Issue 8
- 2019, Falsche Propheten 2014. Antisemitische Agitation auf den „Montagsmahnwachen für den Frieden“, Samuel Salzborn (Hg.): Antisemitismus seit 9/11. Ereignisse, Debatten, Kontroversen, Baden Baden: Nomos, S. 217 – 236
- 2019, „Leid und Mythos. Goethes Iphigenie auf Tauris und Homers Odyssee als Zeugnisse der Dialektik der Aufklärung“, Sans phrase, Heft 15, S. 90 – 100.
- 2018, „Täter und Tatbeteiligte im KZ Sachsenhausen: Fritz Suhren“ Günter Morsch (Hg.): Die Konzentrationslager-SS 1936-1945: Arbeitsteilige Täterschaft im KZ Sachsenhausen, Berlin: Metropol, S. 346-350, (mit Astrid Ley).